
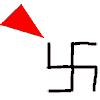
Herausgegeben von der Antifaschistischen Gruppe Frankfurt
Unterstützt von dem Antifa-Referat des AstA der Uni Frankfurt
und dem Antifa-Referat der FH Frankfurt
"Ein Schlussstrich würde das Eingeständnis der Katastrophe bedeuten, es würde das Eingeständnis bedeuten, dass wir keinerlei Perspektive haben, dass die Katastrophe endgültig ist."
Adam König, IG Farben Zwangsarbeiter in Auschwitz-Monowitz
Es ist vollbracht. Eine lange ausstehende "humanitäre Geste" für ehemalige Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen nannte Bundeskanzler Schröder die zum Abschluss gebrachten Entschädigungsverhandlungen. Außenminister Fischer sprach von einem "historischen Tag für die Opfer und für Deutschland". Bundesregierung und deutsche Industrie gründeten gemeinsam eine Stiftungsinitiative. Bereits der Begriff verrät ihre Haltung zu den Entschädigungsansprüchen der ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Eine Stiftung verwaltet geschenktes Vermögen. Es wird also in einem Akt von Großzügigkeit ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern des Nationalsozialismus etwas geschenkt.
Es wird auch viel über Moral gesprochen dieser Tage. Eine Gruppe namhafter Schriftsteller ruft die deutsche Bevölkerung auf, sich mit einer Spende für die ehemaligen Zwangsarbeiter zu ihrer "moralischen Verantwortung" zu bekennen. Dass es sich bei der Entschädigung nicht um ein Präsent, um keine großzügige Geste, sondern um längst überfällige Rechtsansprüche für jahrelang geleistete Zwangsarbeit handelt, wird in der Öffentlichkeit kaum noch wahrgenommen. Die Profiteure des Nationalsozialismus, die 55 Jahre lang nicht zur Rechenschaft gezogen wurden, stellen sich nun, trotz einer niedrigen Zahlung, öffentlich als Gönner dar, die großzügig Spenden verteilen.
Seit dem 8.Mai 1945 wird in Deutschland die Frage nach der Verantwortung für die nationalsozialistischen Verbrechen unentwegt beantwortet. Die erste der immer wiederkehrenden zwei Antworten darauf lautet, dass der Nazi immer "der andere" war. Der Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein beschreibt den Nationalsozialismus als eine Gesellschaft von Wölfen, mit einer klaren Hierarchie, in der das Recht des Stärkeren herrschte. Nur einer hat sich zu verantworten: der Leitwolf, der Führer. Demnach war die gesamte deutsche Bevölkerung unschuldig an den Verbrechen des Nationalsozialismus.
Was jemandem blühen kann, der die Legende von den Deutschen als Unschuldslämmer in Frage stellt, konnte man an dem Umgang mit dem US- amerikanischen Wissenschaftler Daniel Goldhagen beobachten. Eine Flut von öffentlichen antisemitischen Beleidigungen und Diffamierungen war die Reaktion auf seine These, dass die Mehrheit der Deutschen nicht nur von den nationalsozialistischen Verbrechen gewusst, sondern sie darüber hinaus unterstützt und aktiv daran teilgenommen hat. Goldhagen war ein Störfaktor gegen die Versuche, der deutschen NS-Vergangenheit den Rücken zu kehren.
Eine zweite Methode des Umgangs mit der deutschen Vergangenheit ist es, sie in einem allgemeinen Gräuel von Menschheitskatastrophen untergehen zu lassen. Die Singularität von Auschwitz - und alles was dieser Name symbolisiert und materialisiert - wird durch den Vergleich und die Gleichsetzung mit anderen Verbrechen in Frage gestellt. "Der Rote Holocaust"; titelte die "Zeit" 1997 und stellte damit den industriell organisierten Massenmord in den deutschen Vernichtungslagern mit den stalinistischen Straf- und Arbeitslagern auf eine Stufe. Innerhalb dieser sogenannten Weltverbrechen findet auch die "Vertreibung" von Deutschen und die Bombardierung deutscher Städte ihren Platz, so dass sich in einer Top Ten-Liste der Großen Verbrechen die Zerstörung von Dresden und die Umsiedlung der "Sudetendeutschen" neben Auschwitz findet. Dieses Bestreben manifestiert sich auch in dem Mahnmal an der neuen Wache in Berlin, dass sich völlig beliebig gegen "Diktaturen und Gewaltherrschaften" richtet. "Da kann inzwischen jeder seine Kränze hinlegen. Als ich dort war, lag dort ein Kranz einer Witwe zum Gedenken an ihren in Stalingrad gefallenen Ehemann. Und der Kranz einer Offiziersgruppe gedachte ihrer toten Kameraden." (Else Anna Werner, Vorstandsmitglied des Auschwitz-Komitees, im NS verfolgt.)
Begleiterscheinungen dieses Revisionismus, der Verdrängung und der Relativierung nationalsozialistischer Verbrechen war und ist es, den Überlebenden des Holocaust durch die Schändung jüdischer Friedhöfe und mit der Beschwörung antisemitischer Vorurteile das Leben in Deutschland schwer oder unmöglich zu machen.
Wehrmachtsdeserteure, die sich dem deutschen Angriffskrieg widersetzten, werden bis heute als Verräter betrachtet und bekommen keine Rentenzahlungen.
Ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter wurden durch jahrzehntelang verweigerte Entschädigungsleistungen verhöhnt. Während im Land der Täter ehemalige SS-Offiziere pünktlich ihre Rente erhalten, die alten Eliten auch die neuen waren und sind, müssen die überlebenden Opfer um jeden Anspruch kämpfen.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde deutlich, dass Deutschland im Ost-West-Konflikt eine wichtige Rolle spielen würde. Westdeutschland wurde durch das "Wirtschaftswunder", dass maßgeblich auf dem erwirtschafteten Profit durch die Ausbeutung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern während des Krieges basierte, zu einem der wirtschaftlich führenden westlichen Staaten. Gemäß der Logik des Ost-West-Konflikts gab es kein Interesse der Westalliierten, vom deutschen Nachkriegsstaat Reparationen zu fordern oder sich um eine Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern zu bemühen.
Erst mit dem Untergang des real existierenden Sozialismus wurde es, insbesondere für die osteuropäischen Staaten, möglich, Reparationen von Deutschland zu fordern. Nach den Beschlüssen des Londoner Schuldenabkommens von 1953 müsse die Entschädigung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, die außerhalb des Territoriums des Deutschen Reichs von 1937 lebten, durch einen Friedensvertrag geregelt werden. Diesen Vertrag gab es nie. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Abschluss der 2+4-Verträge wurde deutlich, dass die Frage nach Entschädigung weiterhin ausgeklammert wurde.
Die Negierung der deutschen Verantwortung für die NS-Verbrechen wurde in den 90er Jahren durch zahlreiche Debatten und Ereignisse flankiert. Die Organisierung und der Vormarsch der Faschisten würde eine genauere und ausführliche Beleuchtung verdienen, die wir in dieser Broschüre nicht leisten wollen und können - auch weil es hierzu eingehende Arbeiten gibt.
Auf die Debatte um Goldhagen sind wir ansatzweise eingegangen. Handgreiflicher wurde diese Debatte als die Thesen Goldhagens durch die Ausstellung "Verbrechen der Wehrmacht" konkretisiert wurden. Die "anständige, saubere deutsche Wehrmacht" wurde für viele durch die Wehrmachtausstellung "beschmutzt". Erstaunlich war, wie viele sich offen mit der deutschen Wehrmacht identifizieren konnten und wollten. Da doch eigentlich außer Diskussion stehen müsste, dass die Armee eines faschistischen Verbrecherstaates selbstverständlich die gleichen Ideale hat und umsetzt, also unweigerlich so verbrecherisch ist wie die Staatsführung. Der Widerstand gegen die Wehrmachtausstellung stellte einen Höhepunkt in der Zusammenarbeit faschistischer und konservativer Kräfte in Deutschland dar. Der faschistische Aufmarsch in München gegen die Eröffnung der Ausstellung war der größte seit den 70er Jahren. Die Rechten waren erfolgreich: die Wehrmachtausstellung ist vorzeitig beendet worden, die Betreiber beteuern, dass sie eine "Versöhnung" der Generationen erreichen wollen und kündigen an, dass sie beabsichtigen, eine Ausstellung über die Verbrechen in der Ära Stalins zu erarbeiten.
Nicht nur eine Versöhnung mit den Tätern, sondern eine Befreiung der Deutschen von der drohenden "Auschwitzkeule", diesem "jederzeit einsetzbaren Einschüchterungsmittel", mit dem seiner Meinung nach finstere Mächte Deutschland im Würgegriff halten, möchte Martin Walser in der Paulskirche erreichen. Walsers Befreiungsschlag brachte die Frankfurter Paulskirche zu standing ovations, nur drei Personen, darunter der mittlerweile verstorbene Vorsitzende der Zentralrates der Juden, Ignatz Bubis, blieben auf ihren Plätzen.
Am 16. Oktober 1998 zeigte sich das neu gefundene Selbstvertrauen Deutschlands, als mit überwältigender rot-grüner Mehrheit die vorläufige Kriegserklärung des Bundestages angenommen wurde. Es dauerte nur vier Monate, bis der Beschluss umgesetzt werden konnte und unter Rot-Grün zum dritten Mal innerhalb eines Jahrhunderts deutsche Soldaten Ziele in Serbien angreifen und dabei - es sei nebenbei angemerkt - UN-Charta, Nato-Statut und deutsches Grundgesetz gebrochen wurde. Der "Einsatz" der Bundeswehr im Kosovo, erklärte Schröder, habe dazu beigetragen, "historische Schuld und historische Verbrechen, die in deutschem Namen begangen wurden", durch ein neues Bild Deutschlands zu ersetzen, ja, "die historische Schuld Deutschlands auf dem Balkan (die Verbrechen des Ersten und Zweiten Weltkrieges in dieser Region, d.V.) verblassen zu lassen". "Denn wenn Kosovo gleich Auschwitz ist," schrieb die Allgemeine Jüdische Wochenzeitung (15.4.99), "dann war die Shoa auch nicht einzigartig, dann ist Deutschland posthum rehabilitiert als im Grunde ganz normaler Staat mit - wie andere auch - ein paar historischen Schattenseiten. Und die werden derzeit ja entsorgt. Mit Bomben auf Belgrad ist Auschwitz wieder gut gemacht."
Dass dies erst der Anfang ist, wird nicht verborgen. Joschka Fischer drohte, dass es "für die deutsche Außenpolitik keine Begrenzung der Verantwortung mehr" gebe und Scharping sekundierte, man könne "nicht außenpolitisch erste Liga spielen und sicherheitspolitisch in die zweite abrutschen." Legitimiert wurde die Beteiligung an einem Angriffskrieg mit dem Vorwand, ein neues Auschwitz zu verhindern. Ähnliches dürfe sich in Deutschland nicht wiederholen, "Auschwitz verlange vielmehr, dass auch Soldaten des demokratischen Deutschlands bei dem Versuch mithelfen, im Kosovo Schlimmeres notfalls mit der Waffe zu verhindern". Anders gesagt: "Ob mein Großvater auf dem Balkan Gräueltaten verübt hat, ist mir Banane. Ich bin hier die Friedensmacht." (Fallschirmjäger Patrick Braun, 26, aus Wiesbaden.) Gemordet wird nicht mehr trotz, sondern wegen Auschwitz.
Die IG Farben wurde im Jahre 1925 gegründet, als die BASF in Ludwigshafen ihren Firmennamen in "IG Farbenindustrie AG" änderte und sich dabei mit fünf anderen führenden deutschen Konzernen - Farbwerke Hoechst, Bayer und Agfa, Cassela und Kalle - zusammenschloss. So entstand das größte Industrieunternehmen Deutschlands und zugleich eines der größten der Welt. Die IG Farben entwickelten sich im Verlauf des deutschen Faschismus zum Paradebeispiel für die Verknüpfung der deutschen Wirtschaft mit dem nationalsozialistischen System: Schon vor der Machtübergabe ließ der Konzern der NSDAP finanzielle Unterstützung zukommen. Einige ihrer Manager wurden Wehrwirtschaftsführer und planten die Vernutzung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in den Konzentrationslagern sowie in den von den Deutschen besetzen Gebieten Europas. Die IG Farben waren für die Wirtschaft vor allem deshalb von Bedeutung, weil sie Kohle in synthetisches Benzin und synthetisches Gummi (Buna) verwandelte; ohne diese Stoffe war kein Krieg zu führen. Neben ihrer Rolle als Rüstungsbetrieb war der Konzern auch als Besatzer in den von Deutschland eroberten Ländern aktiv.
Das "Office of Military Government for Germany" kommt 1945 in seinem Bericht über die Bedeutung der IG Farben während des Nationalsozialismus zu folgendem Schluss: "Die IG Farben ist Deutschlands mächtigstes Industrieunternehmen; seit ihrer Gründung im Jahre 1925 ist sie häufig als "Staat im Staate" bezeichnet worden. Ohne die riesigen Produktionsstätten der IG Farben, ohne ihre weitgespannte Forschung, ohne ihre reichliche technische Erfahrung und ohne die wirtschaftliche Macht, die in ihren Händen konzentriert war, wäre Deutschland nicht in der Lage gewesen, im September 1939 seinen Angriffskrieg zu beginnen." Ähnlich sahen es auch die IG Farben selbst, mit Stolz verkündigte Dr. von Schnitzler, Mitglied des Vorstands der IG Farben: "Aber erst im Kriege vermochte die deutsche Chemie die große Probe auf ihre Bewährung zu liefern. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass ein moderner Krieg ohne die Ergebnisse, die die deutsche chemische Industrie unter dem Vierjahresplan erzielte, unvorstellbar wäre."
Um die Rüstungsindustrie für den Angriffs- und Vernichtungskrieg Deutschlands zu fortwährender Produktivitätssteigerung zu bringen, um also ihre Profitrate immer höher zu treiben, benötigten die IG Farben Zehntausende von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. In Monowitz bei Auschwitz hatte die IG-Farben zu diesem Zweck ein eigenes Konzentrationslager - Auschwitz 3 - eingerichtet und Zehntausende von Zwangsarbeitern zum Bau eines Buna-Werks drangsaliert. Für den Profit der IG Farben mit der Methode "Vernichtung durch Arbeit" im Konzentrationslager Auschwitz-Monowitz starben mindesten 30 000 Menschen: durch die Selektion, in den Gasöfen Birkenaus, durch das systematische zu Tode schinden beim Bau des IG Farben Buna-Werks, durch den Sadismus der einzelnen IG Beschäftigten oder der SS-Wachleute. Auch an der industriellen Vernichtung der Juden und Jüdinnen war die IG Farben beteiligt: DEGESCH, die Tochterfirma der IG, lieferte das Giftgas Zyklon B.
1945 beschloss der Alliierte Kontrollrat, die IG Farben vollständig zu enteignen. In der Sowjetischen Besatzungszone wurde dies auch vollzogen. In den Westzonen kam es dagegen zu "Entflechtungsverhandlungen", die im Grunde nichts anderes als Neuordnungs- und Rationalisierungsmaßnahmen waren. Die Chemiemultis Bayer, BASF und Hoechst wurden wieder als eigenständige Unternehmen gegründet. Finanzielle Grundlage dieser Neugründungen war das von den bis zum Tode ausgebeuteten Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen erwirtschaftete Kapital der IG Farben. Nur wenige Jahre später machte jedes dieser Unternehmen mehr Umsatz als die Mutterfirma. Von August 1947 bis zur Urteilsverkündung im Juli 1948 kam es zum Prozess vor dem Alliierten Kriegsverbrechertribunal. Mit den 23 Managern wurde erstmals ein Konzern wegen Verbrechen gegen die Menschheit angeklagt. Die Ankläger warfen ihnen unter anderem die Planung und Vorbereitung des Angriffskrieges, Raub und Plünderung und die Versklavung und Tötung der Zivilbevölkerung, der Kriegsgefangenen und Konzentrationslagerinsassen vor. Es kam jedoch zu einem juristisch wie politisch beschämenden Urteil, ganz im Zeichen des Kalten Krieges. Trotz der überwältigenden Beweise gab es nur Minimalstrafen für einige Angeklagte. Zudem waren Anfang 1952 alle Verurteilten vorzeitig frei und kehrten zum Großteil an ihre alten Wirkungsstätten zurück.
Die personelle Verflechtung der IG Farben mit dem Nationalsozialismus und das weitere Wirken der führenden Personen von IG Farben in der BRD. Vier Beispiele:
Heinrich Bütefisch: Vorstandsmitglied IG Farben. Kontakte zu Hitler und Rudolf Hess. Wehrwirtschaftsführer, Obersturmbannführer der SS, Produktionsbeauftragter für Öl im Nationalsozialismus - Rüstungsministerium. Leiter der Abteilung Benzinsynthese in Buna- Auschwitz. Nach 1945 Angeklagter im IG Farben Prozess, 6 Jahre Haft, vorzeitige Entlassung 1951. Aufsichtsratsmitglied der Ruhrchemie.
Friedrich Jähne: Vorstandsmitglied IG Farben. Wehrwirtschaftsführer; Aufsichtsratsmitglied mehrerer IG Farben - Tochterfirmen. Nach 1945 Angeklagter im IG Farben Prozess, verurteilt zu sieben Jahren Haft, 1951 begnadigt. Aufsichtsratsvorsitzender der Hoechst AG.
Fritz ter Meer: Vorstand IG Farben. Verantwortlich für die Planung von Buna. Wehrwirtschaftsführer, Nationalsozialismus-Generalbevollmächtigter für Rüstung in Italien. Nach 1945 Angeklagter im IG Farben-Prozess, sieben Jahre Haft, bereits 1951 entlassen. Aufsichtsratsvorsitzender von Bayer.
Hermann Schmitz: Vorstandsmitglied, Wehrwirtschaftsführer; Reichstagsmitglied der Nationalsozialismus-DAP seit 1933. Nach 1945 Angeklagter im IG Farben-Prozess; 4 Jahre Haft; 1950 vorzeitig entlassen; Aufsichtsratmitglied der Deutschen Bank und Ehrenvorsitzender der Rheinischen Stahlwerke.]
Im Zuge der "Entflechtungsmaßnahmen" des IG Farben-Konzerns gab der Alliierte Kontrollrat die Anordnung, eine Abwicklungsgesellschaft als aktienrechtliche und juristische Nachfolgerin der Firma zu gründen: die IG Farben in Abwicklung. Ihre Aufgabe bestand darin, möglichst rasch unklare Vermögensdinge zu klären, Auslandsverpflichtungen abzuwickeln, Pensionen an die verdienten ehemaligen Direktoren auszuzahlen. Zudem war die Liquidationsgesellschaft für die Entschädigung der ehemaligen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen zuständig. Danach sollte die Gesellschaft sich auflösen. Der Konzern setzte Prioritäten: Von 1948 bis 1957 bezahlten die IG Farben i.A. jährlich 30 Millionen Mark für Pensionen von ehemaligen leitenden Angestellten, unter ihnen auch die Angeklagten des Nürnberger Prozesses, ebenso andere Schreibtischtäter, die gar nicht erst angeklagt wurden. Das war Jahr für Jahr jene Summe, die in den 60er Jahren durch das sog. Wollheim-Abkommen einmalig zur Entschädigung von ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern aufgebracht wurde.
Dieses Abkommen zwischen dem ehemaligen IG Farben Zwangsarbeiter Norbert Wollheim, der Claims Conference und den IG Farben i.A. kam nach einer Entschädigungsklage Wollheims gegen IG Farben i.A. durch internationalen Druck als außergerichtlicher Vergleich zustande. Die IG Farben zahlten einmalig 30 Mio. DM zur Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter; dafür erhielten sie eine Rechtssicherheit vor weiteren Klagen. IG Farben begründeten ihre Zahlung mit einer lediglich moralischen, nicht rechtlichen Verpflichtung, da die Verantwortung für die Zwangsarbeit beim Deutschen Reich gelegen habe. Dies nahmen andere deutschen Profiteure der Zwangsarbeit, sobald sie in vergleichbaren Situationen waren, als Vorbild, so z.B. Krupp, AEG und Siemens. Durch das Wollheim-Abkommen erhielten ca. 6.500 ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter der IG Farben, ausschließlich aus westeuropäischen Staaten, eine einmalige Entschädigung zwischen 2.500 und 5.000 DM.
Nachdem IG Farben i.A. in den 50er Jahren 1,5 Mrd. Mark aus dem alten Konzern-Vermögen an BASF, Bayer, Hoechst und Casella verteilt hatte, fand man schnell ein neues Betätigungsfeld. Von Seiten der IG Farben i.A. wurde dies folgendermaßen kommentiert: "Es war das historische Glück des deutschen Volkes, dass sich die so heterogen zusammengesetzten, im Grunde nur durch das Ziel der Vernichtung der europäischen Diktaturen geeinten Sieger zu entzweien begonnen hatten." Es wurde, ermöglicht auch durch die politischen Konstellationen des Kalten Krieges, mit zum Teil nicht geringem Erfolg versucht, ehemaliges IG Farben-Vermögen wiederzubekommen. So konnte man dann bis zum Beginn der Proteste Mitte der 80er Jahre unbehelligt vor sich hin wirtschaften. Ende der 80er Jahre schien die Liquidationsgesellschaft dann kurzzeitig tatsächlich vor der Auflösung zu stehen, da es keine offenen Restitutionsansprüche mehr gab. Dies änderte sich 1990. Die Aktionäre witterten Morgenluft: Nach der deutschen Vereinigung hoffen sie auf Rückgabe von Immobilien und Grundstücken, die in der Sowjetischen Besatzungszone enteignet worden waren. "Unsere Liquidatoren haben unser Vermögen zurückgeholt aus Honduras, Ägypten, Wien und da sollen wir kapitulieren davor, was uns die alten Stalin-Gangster weggenommen haben?" wird ein Aktionär zitiert und ein anderer formulierte auf der Hauptversammlung 1991: "Sprechen wir doch von Auschwitz einmal andersherum. Welche Vermögenswerte haben wir eigentlich in Polen?"
Um ihren neuen Geschäften in Ruhe nachgehen zu können, versuchten IG Farben i.A. sogar, ihren Namen zu ändern, was jedoch vor Gericht scheiterte. Anfang der 90er Jahre besaß der Konzern noch ein Barvermögen von rund 100 Mio. DM, von diesem Betrag waren 1999 etwa 28 Mio. übrig, der Differenzbetrag wurde offensichtlich zu anderen Firmen verschoben. 1996 scheiterten die letzten Ansprüche auf Rückübertragung des ehemaligen Ostvermögens höchstrichterlich. Mit den wirtschaftlichen Aktivitäten der IG Farben i.A. (getarnt durch zwei Tochterfirmen) ging es ebenfalls bergab, aber an Auflösung dachte der Konzern nicht. Für Außenstehende ist es mittlerweile nicht mehr durchschaubar, wer tatsächlich das Sagen bei IG Farben hat und mit welchen Interessen dort gehandelt wird. IG Farben geht es derweil besser denn je; die Tochterfirmen schreiben erstmals seit Jahren wieder schwarze Zahlen, ein neues Milliardenprojekt in der Schweiz ist entdeckt worden und mittels einer Stiftung soll die Vergangenheit endgültig begraben und vergessen werden.
Seit Herbst 1998 hat IG Farben zwei neue Liquidatoren, die im Gegensatz zu ihren Vorgängern eine neue Form der Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Schluss mit der Geheimniskrämerei, orientieren wir uns an der rot-grünen Bundesregierung, so scheint das Firmenmotto seither zu lauten. Der bisher extrem publicity-scheue Konzern veranstaltet Pressekonferenzen und hat analog zu den Diskussionen um einen Industriefonds zur Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern auf der Hauptversammlung im August 1999 beschlossen, eine Stiftung einrichten, um die unliebsame Vergangenheit zu liquidieren. Die Stiftung soll mit 3 Mio. DM ausgestattet sein, deren jährliche Rendite (bei 10% also 300.000 DM, Eigenschätzung IG Farben) zur Entschädigung der noch laufenden, etwa 500 Klagen dienen soll. Zur Erinnerung: zwischen 1947 und 1958 zahlten IG Farben i.A. Jahr für Jahr 30 Mio. DM Pensionen an ehemalige Angestellte, darunter die im IG Farben-Prozess verurteilten Kriegsverbrecher.
Die 1999 verabschiedete Stiftung scheint ihren Zweck bereits erfüllt zu haben: die Proteste gegen IG Farben lassen sich immer schwerer vermitteln, die ehemals kritisch gegen IG Farben eingestellte Presse ist weitgehend positiv der Stiftung gegenüber eingestellt. Bei den Hauptversammlungen werden nach wie vor Überlebende, JournalistInnen und Protestierende, teilweise unter Einsatz körperlicher Gewalt, des Saales verwiesen. Initiiert von ehemaligen Zwangsarbeitern und Angehörigen von Ermordeten gibt es seit 1986 kontinuierlichen Widerstand und Protest gegen IG Farben. Diese Proteste stießen innerhalb der radikalen Linken oder der Autonomen Antifa lange Zeit nur auf schwache Resonanz; dies änderte sich erst Mitte der 90er Jahre. Seither beteiligte sich ein breiteres Spektrum an den Protestaktionen. Es kam in den letzten Jahren zu Rangeleien und Eierwürfen; der Protest wurde auch in die Hauptversammlungen getragen. IG Farben reagierte mit dem Einsatz eines Sicherheitsdienstes in schwarzen Uniformen, dessen Mitarbeiter teilweise aus neonazistischen Skinheads bestanden. So wurde Hans Frankenthal, Überlebender aus dem IG Farben-KZ, im August 1999, weniger als ein halbes Jahr vor seinem Tod, von Neonazis gewaltsam aus der Hauptversammlung geworfen. Gleichzeitig weitete auch die Polizei ihre zum Schutz der Aktionäre getroffenen Maßnahmen aus.
Hans Frankenthal war einer der aktivsten Vertreter der kritischen Aktionäre der IG-Farben in Abwicklung. Er überlebte zusammen mit seinen Bruder die mörderische Zwangsarbeit in den Buna Werken in Auschwitz-Monowitz und anderen Rüstungsbetrieben und schließlich auch einen der berüchtigten Todesmärsche. Nach der Befreiung kehrte Frankenthal in seine Heimat Schmallenberg im Sauerland zurück.
An der Rampe im KZ Auschwitz hatte ihn sein Vater noch zugerufen: "Ich werde das nicht überleben, ich bin zu alt. Aber solltest du das überleben, geh nach Schmallenberg zurück." Dies war das letzte mal, das Hans Frankenthal seinen Vater sah. Nach rund vier Jahren Zwangsarbeit, zwei davon im KZ Monowitz/Auschwitz III bei der IG Farben, kehrte er als einer von sieben von ehemals 56 Schmallenberger Juden aus dem KZ zurück. Man legte ihnen nahe, die ganze Sache doch einfach zu vergessen. "Sie sind doch auch ein gottesgläubiger Mensch?" musste sich Hans Frankenthal vom örtlichen Pastor anhören. Die Behörden in seiner Heimatstadt verlangten von ihm, sich in der Gemeinde wieder anzumelden. Doch er weigerte sich; "Warum sollten wir uns den anmelden, wir hatten uns doch nie abgemeldet?" Hans Frankenthal setzte sich mit den alten Nazis vor Ort - am Stammtisch und vor Gericht - unbeirrbar auseinander. Er konnte und wollte nicht vergessen, was seiner Familie und ihm, was Millionen Menschen angetan wurden.
Hans Frankenthals linkes Knie war als Folge einer Entzündung während des Todesmarsches steif. Während der Haftzeit hatte man ihn für medizinische Versuche missbraucht. "Mit der Einstufung meiner Erwerbsfähigkeit als um 40% gemindert erhielt ich 1953 eine Teilrente von 93,33 DM". Die Leute in Schmallenberg, die ihn eingestuft, registriert und begutachtet hatten, waren nachweislich ehemalige Nazis oder Nazi-Sympathisanten. "Die ganze Entnazifizierung war eine einzige Farce. Niemand ist gegangen worden." Fünftausend erhielt er schließlich für das "Nichterlernen eines Berufes". Nach einer Gesetzesnovelle noch mal den gleichen Betrag. Das Haus seiner Eltern wurde ihm erst 1960 wieder übertragen. Doch nicht einfach so. "Die Stadt forderte Eintausenddreihundert DM als Rückerstattung für die dreizehntausend Reichsmark, die mein Vater nach dem erzwungenen "Verkauf" seines gesamten Vermögens nach der Pogromnacht angeblich erhalten hatte."
"Für mich spielt das Geld keine Rolle. Ich kämpfe um die Menschen, denn was geschehen ist, kann man sowieso nicht wiedergutmachen." Hans Frankenthal kämpfte dafür sein ganzes Leben. Seit 1986 lebte er in Dortmund. Seinen ersten Wohnsitz hatte er aber weiterhin in Schmallenberg. "Ich möchte einfach nicht, dass Schmalenberg judenrein an den Ortseingang schreiben kann." Er trat in den Aktionärsversammlungen der IG Farben in Abwicklung auf und verlangte deren Auflösung und die Entschädigung der Opfer. Bei der Jahreshauptversammlung im August 1999 wurde ihm während seiner Rede das Wort entzogen und auf Anweisung der Versammlungsleitung wurde er von Saalschützern hinausgeworfen.
Hans Frankenthal war u.a. im Direktorium des Zentralrates der Juden in Deutschland, im Vorstand des internationalen Auschwitzkomitees und Vorsitzender des Bundesverbandes der Beratungsstellen für NS-Verfolgte. Im Februar 1999 erzählt er: "Momentan arbeite ich nach wie vor von morgens bis abends, bin in der jüdischen Gemeinde aktiv, kümmere mich um die Erinnerung an unsere Verfolgungsgeschichte, besuche weiterhin Schulen und vieles mehr. Meine Geschichte wird mich bis in den Tod nicht mehr loslassen, trotzdem bin ich ein fröhlicher Mensch." Hans Frankenthal starb am 22. Dezember 1999 im Alter von 73 Jahren.
In weiten Teilen der Presselandschaft, auch und gerade der internationalen, stieg das Interesse und meistens wurde Sympathie für die Proteste und Unverständnis über das Fortbestehen von IG Farben i.A. gezeigt. Seit 1997 ist kein Hotel in Frankfurt mehr bereit, die Hauptversammlung der Gesellschaft zu beherbergen, im gleichen Jahr sind bei der in einem Bürohaus stattfindenden Aktionärsversammlung zum ersten Mal mehr Demonstranten und Demonstrantinnen als Aktionäre vor Ort. 1998 gelingt es IG Farben nicht, in Frankfurt einen Raum zu finden, in dem die Hauptversammlung stattfinden kann. Dies dürfte auch einer der Gründe für den bereits erwähnten "Kurswechsel" hinsichtlich der Entschädigungsthematik sein. In Frankfurt wurde im Rahmen dieses Aktionstages zum zweiten Mal seit Beginn der Proteste das Büro der IG Farben besetzt, um den Forderungen der Überlebenden Nachdruck zu verschaffen: man wollte das Büro nicht verlassen, bis IG Farben sich aufgelöst haben. Die Besetzung wurde nach mehreren Stunden, in denen auch eine Pressekonferenz in den Büroräumlichkeiten abgehalten wurde, von der Polizei geräumt.
Im März 1999 wurde die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 1997 in der Stadthalle Bergen-Enkheim, einem Frankfurter Stadtteil, unter massivem Schutz der Polizei und des erwähnten Sicherheitsdienstes nachgeholt. Die Proteste gegen die beiden letzten Hauptversammlungen wurden von einem bundesweiten Bündnis getragen, dem u.a. das Internationale Auschwitz Komitee, der VVN/BDA, die kritischen Aktionäre sowie verschiedene Antifagruppen angehören. Das Motto der Protestaktion 2000: Nie wieder! Hauptversammlung der IG Farben i.A.
Im Zusammenhang mit der "großen" Entschädigungsdebatte symbolisiert die Geschichte und das Verhalten von IG Farben doch im Kleinen die ganze Farce, Verlogenheit und Schäbigkeit des Industriefonds zur endgültigen Entsorgung der nationalsozialistischen Vergangenheit.
Das Bündnis gegen IG-Farben fordert, das gesamte Kapital von IG Farben folgenden Zwecken zur Verfügung zu stellen:
"Am Ende dieses Jahrhunderts wollen die BRD und deutsche Unternehmen, die bisherigen umfangreichen Wiedergutmachungsregelungen ergänzend, ein Zeichen ihrer moralischen Verantwortung für diese Geschehnisse setzen. Abschließend kann das nur in finanzieller Hinsicht sein" (Präambel des Entwurfs eines Gesetzes zur Errichtung der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft")
Am Ende dieses Jahrhunderts schafft sich Deutschland alle Verbindlichkeiten aus der nationalsozialistischen Zeit vom Hals und möchte dies als ein "Zeichen ihrer moralischen Verantwortung" weltweit anerkannt bekommen. Doch die Stiftungsinitiative ist mehr als ein Ausdruck dieser Kontinuität. Sie ist der wahrscheinlich erfolgreiche Versuch, einen endgültigen Schlussstrich unter die deutsche Nationalsozialistische Vergangenheit zu ziehen.
Die ersten Entschädigungsgesetze und -initiativen waren keine von Deutschland initiierten, sondern wurden von der amerikanischen Militärregierung erlassen. So ermöglichte z.B. das Rückerstattungsgesetz von 1947 erste Entschädigungen für geraubtes jüdisches Eigentum. Kleinere Gesetzesinitiativen folgten, bis es sechs Jahre später zum ersten größeren, vom Bundestag angenommenen Abkommen bezüglich einer Entschädigung kam, dem "Luxemburger Abkommen". Dieses vom deutschen Bundestag widerwillig im März 1953 angenommene Abkommen legte u.a. erste sogenannte Wiedergutmachungen für Israel fest.
Es war das Ergebnis eines langen, harten Kampfes, den Vertreter des jüdischen Weltkongresses, der Conference on jewish material claims und Israels gegen die deutsche Regierung führten. Am Ende dieses Kampfes stand die Vereinbarung, dass Deutschland 3 Milliarden DM an den israelischen Staat sowie 500 Millionen DM an die Claims Conference zahlen mußte. Zur Zeit der Verhandlungen befand sich Israel in schwieriger finanzieller Lage. Diese Situation wurde von Deutschland ausgenutzt; man bot eine lächerlich geringe Summe zur Entschädigung. Zudem wurde dieses Unterfangen von heftigen antisemitischen Ausfällen flankiert.
Am 25. März 1952 wies der damalige Finanzminister Schäffer alle Oberfinanzdirektionen an, die seit 1945 "von Juden begangenen Devisenzuwiderhandlungen" und die von Juden seit der Währungsreform von 1948 bewirkten "Verkürzungen der Zoll- und Verbrauchssteuern" zu berechnen. Gemeint waren damit sogenannte Schwarzmarktgeschäfte in den Displaced Persons-Lagern, in denen u.a. dem Holocaust entkommene Juden und Jüdinnen untergebracht worden waren. Am 12. Mai 1952 verkündete Schäffer, dass die Untersuchung erbracht habe, "dass die Juden Gesamtschaden von 10 Milliarden DM verursacht haben." Wer damit in wessen Schuld stehe, sei zur genüge ersichtlich. Deutschland bewog hier wie bei allen späteren Fällen allein strategisches Interesse sowie massiver Zwang zu der Annahme des Abkommens. Nur dieser Mischung aus eigenen Interessen und externem Druck ist es zu verdanken, wenn in der Geschichte der BRD überhaupt Entschädigungen gezahlt wurden.
Das Bundesentschädigungsgesetz (BEG) vom Juni 1956 brachte einige geringfügige Verbesserungen. So wurden beispielsweise die bisher geltenden Wohnsitz- und Stichtagsvoraussetzungen erweitert sowie die Höchstgrenze für Leistungen bei Schäden an Eigentum und Vermögen erhöht. Folgende Präambel wurde, als Zeichen des guten Willens, dem Gesetz vorangestellt: "In Anerkennung der Tatsache, dass Personen, die aus Gründen politischer Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verfolgt worden sind, Unrecht geschehen ist, hat der Bundestag das nachstehende Gesetz beschlossen." Das war alles, was sich das "Gewissen der Nation" abringen konnte: den Verfolgten, den Abermillionen von Deutschland ermordeten war Unrecht geschehen, mehr nicht. Unrecht, wie es eben so oft und mannigfaltig in der Welt geschieht. Demnach sparte man auch nicht bei der Entschädigung, es herrschte schließlich Wirtschaftswunder: Hatten Überlebende mühsam nachweisen können, dass sie einen sogenannten Freiheitsschaden erlitten hatten, bekamen sie für jeden Monat Freiheitsentzug 150 DM, 5 DM pro Tag.
Von Anfang an wurden allerdings Gruppen aus dem Bundesentschädigungsgesetz ausgeschlossen: Diejenigen, die im Ausland von den deutschen Mordkommandos heimgesucht worden waren, und, da sie in ihren Heimatländern geblieben waren, nicht die im Gesetz vorgesehenen Wohnsitzvoraussetzungen erfüllten. D.h. alle französischen, belgischen, holländischen, dänischen, norwegischen, griechischen, jugoslawischen, italienischen, polnischen, tschechischen, rumänischen und russischen Juden und Jüdinnen. Die Angehörigen der Widerstandsbewegungen in den jeweiligen Ländern, Polen und Russen, insbesondere russische Kriegsgefangene, welche als sogenannte Untermenschen auch Opfer der nationalsozialistischen Ausrottungspolitik wurden. Die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen allgemein. Die Zwangssterilisierten. Die sogenannten Gemeinschaftsfremden (von den Nazis als "Asoziale" bezeichnet). Die Kommunist und Kommunistinnen. Die Sinti und Roma. Die Schwulen.
Während auch die Erben der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter entgegen den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches leer ausgehen sollen, vererbte die deutsche Tätergeneration in den vergangenen fünf Jahren 2.000.000.000.000 DM. Die Nachkommen der Tätergeneration sind auch die Erben der Nürnberger Gesetze sowie der Gewinne aus der "Vernichtung durch Arbeit". Oder wie es der Vorsitzende des Zentralrats der griechischen Juden drastisch ausgedrückt hat: "Deutschland erbt statt jener, die nicht mehr erben können, weil sie zu Seife geworden sind."
Eine der größten Härten des BEG für die wenigen überhaupt Anspruchsberechtigten waren seine kurzen Ausschlussfristen. Ein riesige Anzahl Verfolgter hat niemals einen Antrag auf Entschädigung gestellt. Sei es aufgrund der Antragsfristen, sei es, dass sie nie von der Existenz des BEG benachrichtigt worden sind oder sei es, weil sie eine Retraumatisierung fürchteten. Bis zu der Einführung des Bundesentschädigungsgesetzes bestand die Argumentation zur Verhinderung von Entschädigungszahlungen bei Zwangsarbeit darin, den AntragstellerInnen mitzuteilen, sie kämen zu früh: Die Entschädigung der ehemaligen ZwangsarbeiterInnen müsse laut Londoner Schuldenabkommen ein Friedensvertrag regeln, bis dahin sehe man keine Verpflichtung zu Zahlungen. Waren die Kläger jedoch ehemalige ZwangsarbeiterInnen aus Deutschland, so fand die Argumentation mit dem Londoner Schuldenabkommen auf sie keine Anwendung. Dass diese Gruppe trotzdem mit leeren Händen aus Prozessen herausgingen, lag in der Auffassung der Rechtsprechung begründet, die Ansprüche der Kläger seien verspätet geltend gemacht worden und damit verjährt. Mit dem Ende der minimalen Antragsfristen des Bundesentschädigungsgesetzes sekundierte also auch diese Begründung bei einer Verweigerung von Zahlungen. Nun waren die ZwangsarbeiterInnen nicht mehr nur zu früh gekommen, jetzt waren sie auch zu spät - die Fristen waren abgelaufen.
Und genau diese Argumentation bringt die Perfidie Deutschlands im Umgang mit Entschädigungsforderungen auf den Punkt: Man konnte zu früh kommen, man konnte zu spät kommen, nur zur rechten Zeit konnte man niemals kommen. Die meisten Kämpfe, die ehemalige ZwangsarbeiterInnen gegen deutsche Firmen führten, endeten in der erneuten Demütigung der Kläger. Die bis hierhin erwähnten Argumentationsmuster zur Abwehr von Entschädigungsforderungen haben sich zum großen Teil bis heute nicht verändert. Diejenigen, die im Auftrag der Bundesregierung die Entschädigungsregelungen ausarbeiteten und die Verhandlungen mit den Opfern des deutschen Faschismus führten, waren neben kühlen Wirtschaftsstrategen vor allem Nazis und Antisemiten. Die Entschädigungsregelungen der 50er und 60er Jahre waren Manifestationen der Kontinuität zwischen dem Nationalsozialismus und dem "neuen Deutschland". Anstelle von Solidarität mit den Überlebenden - welche einen Bruch mit dem deutschen Faschismus markiert hätte - gab es für sie nur den geballten Hass der Volksgemeinschaft.
Nachkriegszeit beendet? Mit Abschluss des "Luxemburger Abkommen" und des Bundesentschädigungsgesetzes fühlte sich Deutschland vor weiteren Entschädigungsforderungen sicher. So sicher, dass Bundeskanzler Ludwig Erhard in seiner Regierungserklärung 1965 die Nachkriegszeit für beendet erklärte. Der Abschluss eines Friedensvertrags, welcher auch Zahlungen an bisher ausgeschlossene Opfer des Nationalsozialismus regeln müsste, war nicht in Sicht. Zudem hoffte man auf die "biologische Lösung", sprich: auf den Tod der meisten oder am besten aller Überlebenden, da ja ein Friedensvertrag über 40 Jahre lang in weiter Ferne schien.
Im Jahr 1989 machte es für kurz den Anschein, als durchkreuze die deutsche Wiedervereinigung und der Zusammenbruch der Sowjetunion diese Sicherheit. Die Blockkonfrontation brach weg und mit ihr langsam auch die Rücksichten der USA und anderer westlicher Staaten gegenüber dem "Frontstaat" BRD, welche zu reparationspolitischer Schonung geführt hatte. Immer mehr Ansprüche, vor allem aus ehemaligen Ostblockländern, wurden in den folgenden Jahren an Deutschland gestellt: so z.B. die Forderung nach Entschädigungszahlungen an jüdische Verfolgte der baltischen Staaten, Rentenregelung für nach Israel eingewanderte osteuropäische Juden, Gründung eines Fonds für Opfer des Nationalsozialismus aus der Tschechei. Fast alle Zugeständnisse, die dabei gemacht wurden, waren mit Gegenforderungen an die Staaten verbunden, in denen die überlebenden Opfer des Nationalsozialismus lebten. Wiederum gingen jedem dieser Abkommen äußerst harte Verhandlungen voraus, in denen die Forderungen der Opfer auf ein Minimum gedrückt wurden. So gelang es Deutschland auch nach der Wiedervereinigung im wesentlichen weiterhin, nicht zu entschädigen.
Diese Situation änderte sich ab 1997 mit den Sammelklagen von Überlebenden gegen schweizerische Banken und deutsche Unternehmen. Als schweizerische Finanzinstitute bei Restitutionsverhandlungen ihre Kompromissbereitschaft bekundeten, war in Deutschland klar, dass die Auseinandersetzungen mit den Überlebenden des Holocaust unter den gegebenen Umständen nicht mehr ohne bedeutende finanzielle Zahlungen niederzulegen seien. Es begann eine fieberhafte Suche nach neuen Abwehrmöglichkeiten von Entschädigungsforderungen. In diese Entwicklung kam der September 1998 und mit ihm der Regierungswechsel zu einer rot-grünen Bundesregierung.
Kurz vor der Bundestagswahl kündigte der designierte Bundeskanzler Schröder an, es würde noch im Jahr 1998 eine Regelung für die Entschädigung ehemaliger ZwangsarbeiterInnen geben. Im Oktober 1998 kam es zu einem Treffen der führenden deutschen Unternehmen mit Bundeskanzler Schröder. Der Tenor der Beratungen war eindeutig, hatte Gerhard Schröder doch vorher vollmundig deklariert, dass die deutsche Industrie sich voll und ganz auf den Schutz des deutschen Staates verlassen könne. Die in den Koalitionsverhandlungen vereinbarte Gründung zweier Entschädigungsinitiativen - eine für ZwangsarbeiterInnen, die andere für die vom Bundesentschädigungsgesetz bewusst ausgelassenen Opfer - nahmen mit diesem Treffen und den Aussagen Schröders Gestalt an - es ging um die endgültige Erledigung jedweder Entschädigungsansprüche.
Dies belegen auch Aussagen, die Günter Saathof, "Entschädigungsexperte" der Grünen, 1998 auf einer Fachtagung von sich gab: "Dabei wird man für die zahlungswilligen Firmen auch eine gewisse Schutzkonstruktion erfinden müssen. Denn diese werden nicht bereit sein, etwas in eine Stiftung einzuzahlen, wenn gleichzeitig die Opfer gegen sie private Klagen anstrengen. Orientieren kann man sich dabei an dem Gesetz über den Aufruf der Gläubiger der I.G. Farbenindustrie i.A.: Hier wurde gesetzlich festgelegt, dass nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, weitergehende Ansprüche nicht mehr gestellt werden dürfen." Die hier geäußerten "Denkanstöße" Saathofs zur endgültigen Entrechtung der zu Entschädigenden wurden dankbar als Grundvoraussetzungen eines Bundesentschädigungsfonds aufgenommen.
Dass Saathof ausgerechnet das IG Farben-Abkommen von 1957 als historisches Vorbild heranzieht, ist besonders perfide: War das Abkommen schon damals eine Manifestation des Schlussstrichwillens, so ist der erneute Bezug darauf die Bekräftigung eines Vorhabens, das damals unverschuldet scheiterte: die Erledigung der Entschädigungsfrage. Diesem Credo verpflichtet, führte die rot-grüne Regierung Verhandlungen um einen Bundesentschädigungsfonds; Deutschland wich dabei keinen Millimeter von seinen Positionen ab und die Verhandlungen zogen sich in die Länge. So kam es zu einer merklichen Verzögerung und Behinderung der Fusion zwischen der Deutschen Bank und dem US-amerikanischen Bankers Trust. Gleichzeitig wuchs der Druck auf deutsche Unternehmen, da immer mehr Klagen von ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern gegen sie eingereicht wurden.
Die Beauftragten der deutschen Regierung unter Leitung von Otto Graf Lambsdorff haben ihre Version der Entschädigungen durchgesetzt. Einer Regelung der Entschädigung gemäß den Forderungen der Überlebenden der nationalsozialistischen Zwangsarbeit wurde damit eine endgültige Absage erteilt. In den Verhandlungen wies die deutsche Delegation immer wieder darauf hin, dass es keinen Entschädigungsfond geben wird, wenn nicht vorher den deutschen Unternehmen Rechtssicherheit vor weiteren Klagen zugesichert werde.
Alle Unternehmen, die zu den Gründern des Fond zählen, haben einen hohen Export zu verzeichnen, gerade auch in die USA. Für Unternehmen wie DaimlerChrysler oder Siemens ist die Beteiligung an dem Fond dann auch in erster Linie unter Public Relations abzubuchen.
Neben Rechtssicherheit und PR wird jedoch wie seit den 50er Jahren weiterhin vor allem ein Ziel angesteuert: Deutschland und seine Industriekonzerne wollen sich endlich von ihrer Nazi-Vergangenheit reinwaschen, ein Schlussstrich soll gezogen und die durch die militärische Niederlage von 1945 auferlegten Beschränkungen Deutschlands aufgehoben werden. Da die Vergangenheit trotz aller Bemühungen der Walsers den Deutschen noch immer ihren Platz an der Sonne verdunkelt, wird nun zur ihrer Entsorgung auf ein altbewährtes Mittel zurückgegriffen, den Ablaßhandel. "Die Münze in dem Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt." So einfach ist der Umgang mit der Vergangenheit, durch den Kauf eines Ablassbriefes - der Beteiligung an dem Entschädigungsfond - werden den Unternehmen ihre Verbrechen vergeben und vergessen. Und umso wichtiger war der Erwerb von Ablassbriefen, je eher es in Zukunft wieder zu Sünden kommen würde.
Dass die Unternehmen mit ihren Zahlungen nur an das eigene Seelenheil denken, zeigt sich nicht zuletzt an ihrer unnachgiebigen Haltung während der Verhandlungen und an der lächerlich geringen Summe, die sie zu zahlen bereit sind. Besonders zynisch ist dabei, dass den Tätern und ihren Nachfolgern nach fast 50 Jahren aufgeht, dass sie sich mit dem Entschädigungen beeilen müssen. Sie weisen immer wieder darauf hin, dass die Überlebenden bald verstorben sein werden und daher die Verhandlungen über die Entschädigungen möglichst schnell abgeschlossen werden müssen.
Mit dem pervertierten Argument, es müsse eine schnelle, "unbürokratische" Lösung herbeigeführt werden, da immer mehr ehemalige ZwangsarbeiterInnen stürben, wird versucht, endgültig jede Kritik an diesen Machenschaften zu verhindern. Hier wird suggeriert, diese Situation sei neu, als wären nicht schon knapp 90% der befreiten ZwangsarbeiterInnen gestorben. Am 17.09.1954 schreibt der "Aufbau" in New York: "Täglich sterben überalterte Entschädigungsberechtigte weg, ehe sie auch nur einen Pfennig von ihrer Entschädigung gesehen haben." Offensichtlich brauchen in Deutschland solche Nachrichten knapp 45 Jahre, bis sie durch die Hirnrinden gesickert sind.
Es wird deutlich gemacht, dass es immer noch Deutschland ist, welches die Definitionsrechte an dem Nationalsozialismus und seinen Opfern hat. Was gut für die Opfer ist und was nicht, entscheidet Deutschland. Die Opfer werden erneut gedemütigt und unter das Kuratel "deutscher Entschädigungsexperten" gestellt. Ihrer individuellen Rechte beraubt werden sie zu Bittstellern degradiert: ihr individuelles Leid und die daraus resultierenden Folgen werden durch Pauschalzahlungen verleugnet. Sie selbst sollen dabei zum zweiten Mal zwangshomogenisiert und als Repräsentanten einer Gruppe, die es ruhig zustellen gilt, abgefertigt werden.
"Die Tatsache, dass die Opfer sehr alt und oft außerordentlich bedürftig sind, hat uns gezwungen, den Vergleich zu akzeptieren, obwohl wir ihn kaum für befriedigend halten."
So fasst Deborah Sturman, eine der Anwältinnen in den USA, die Erpressungstaktik der deutschen Verhandlungsseite zusammen. Teil dieser Erpressungstaktik war es, öffentlich den Eindruck zu erwecken, die "überzogenen Forderungen" der Anwälte verhinderten, dass die wenigen, noch lebenden ZwangsarbeiterInnen überhaupt noch etwas erhielten. Zur Unterfütterung dieser Propaganda wurde unverhohlen der Antisemitismus mobilisiert. So drohte Manfred Pohl (Leiter des historischen Instituts der Deutschen Bank) wenn noch weiter "gefeilscht" werde, könne "in Deutschland eine neue Welle des Antisemitismus entstehen".
In der Präambel des Gesetzentwurfes zur Errichtung der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (s.u.) heißt es: "Die Bundesrepublik Deutschland und deutsche Unternehmen wollen ein in finanzieller Hinsicht abschließendes Zeichen ihrer moralischen Verantwortung setzen." Mit der Formulierung der "moralischen Verantwortung" wird unterschlagen, dass es sich um beim Londoner Schuldenabkommen zurückgestellte Forderungen von Staaten und von Angehörigen dieser Staaten handelt. Also um Reparationen für von Deutschland begangene Verbrechen und nicht um Spenden aus "moralischer Verantwortung" wie etwa für die Opfer einer Naturkatastrophe.
Der vorliegende Gesetzesentwurf schafft Rechtssicherheit für die Täter und Profiteure und sorgt für die Entrechtung der Opfer. In der Regelung lautet es: "Jeder Leistungsberechtigte gibt im Antragsverfahren eine Erklärung ab, dass er mit Erhalt einer Leistung nach diesem Gesetz auf jede darüber hinausgehende Geltendmachung von Forderungen gegen die öffentliche Hand für Zwangsarbeit und Vermögensschäden sowie auf alle Ansprüche gegen deutsche Unternehmen im Zusammenhang mit nationalsozialistischem Unrecht unwiderruflich verzichtet." Diese Verzichtserklärung ist bereits im Antragsverfahren abzugeben, bevor die Antragstellenden überhaupt wissen, ob sie etwas und falls ja, wieviel sie erhalten.
Moral hin, Moral her; ohne Rechtssicherheit - für die Täter, nicht für die Opfer versteht sich - gibt es gar nichts. Otto Graf Lambsdorff hat mit dem Abschluss der Verhandlungen für Deutschland die "Grundlage geschaffen, Sammelklagen zu begegnen und rufschädigende Kampagnen gegen Deutschland und seiner Wirtschaft den Boden zu entziehen" (FAZ). Damit ist das deutsche Verhandlungsziel auf den Punkt gebracht. Reparationsforderungen, Entschädigungsforderungen, die Forderung nach Rückgabe (bzw. Entschädigung) "arisierten" Vermögens usw. gelten in dieser Logik als "Kampagne gegen die Rufschädigung Deutschlands und seiner Wirtschaft". Der Gesetzentwurf schließt einerseits durch die Vergaberichtlinien große Gruppen der ehemaligen NS-ZwangsarbeiterInnen aus (s.o.). Andererseits sollen sämtliche denkbaren Folgen nationalsozialistischer Unrechtstaten, aus denen finanzielle Ansprüche folgen könnten, mit der Abwicklung dieses Gesetzes ausgeschlossen sein. §11 des Gesetzentwurfes legt fest, wer demnach leistungsberechtigt ist und teilt diese in drei Gruppen ein.
Nicht erwähnt bei den Leistungsberechtigten werden ZwangsarbeiterInnen aus der Landwirtschaft. Ausdrücklich eingeschlossen sind Vermögensschäden, die demzufolge auch aus dem Stiftungstopf zu zahlen sind. Zudem enthält dieser Paragraph eine Öffnungsklausel, nachdem die Partnerorganisationen "Leistungen auch solchen Opfern nationalsozialistischer Unrechtsmaßnahmen gewähren, die nicht zu einer der in Satz 1 genannten Fallgruppen gehören". Mit dieser Öffnungsklausel können die Bundesregierung und deutsche Unternehmen zukünftig alle Ansprüche aus dem Nationalsozialismus mit Verweis auf die Stiftung abwehren. Durch die Vergaberichtlinien werden weitere Verfolgte des Nationalsozialismus diskriminiert: alle, die keiner Partnerorganisation zuzuordnen sind und diskriminierend dem "Rest der Welt" zugeordnet werden.
Dies sind im wesentlichen folgende Gruppen:
Zusätzlich werden noch 700 Mio. DM aus dem Stiftungsvermögen für einen Fond "Erinnerung und Zukunft" verwandt. Damit soll die "Erinnerung an den Holocaust und vielfaches Nationalsozialistisches Unrecht" wach gehalten werden. So wird auch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus auf eine Stiftung abgeschoben. Dem großen Frieden mit den Tätern nach 1945 folgt die Etablierung Deutschlands als imperialistische Hegemonialmacht in EU-Europa. Die Verbrechen der Vergangenheit werden mit einer Stiftung abgewickelt und in Berlin in ein Museum eingemauert. Da bleibt nur noch zu hoffen, dass das Vorbild Griechenland Schule macht: Dort wird deutschen Einrichtungen wie dem Goethe-Institut mit der Pfändung gedroht, da sich Deutschland bislang weigert, an griechische NS-Opfer Entschädigung zu zahlen. Weiter so!
Benjamin B. Ferencz: Lohn des Grauens - Die verweigerte Entschädigung für jüdische
Zwangsarbeiter, Frankfurt / New York 1981.
Arbeitskreis IG Farben der Bundesfachtagung der Chemiefachschaften: ...von
Anilin bis Zwangsarbeit, Aachen, Bonn, Braunschweig, Freiburg, Karlsruhe, Würzburg
1994.
Eike Geisel: Triumph des guten Willens - Gute Nazis und selbsternannte Opfer
- Die Nationalisierung der Erinnerung, Berlin 1998.
Die Lebenserinnerungen von Hans Frankenthal: "Verweigerte Rückkehr. Erfahrungen
nach dem Judenmord", Lebensbilder, Bd. 18.
Norbert Frei: Vergangenheitspolitik - Die Anfänge der Bundesrepublik und die
Nationalsozialismus-Vergangenheit, München 1997.
Wolfgang Schneider (Hg.): Wir kneten ein KZ - Aufsätze über Deutschlands Standortvorteil
bei der Bewältigung der Vergangenheit, Hamburg 2000.
Rolf Surmann, Dieter Schröder (Hg.): Der lange Schatten der Nationalsozialismus-Diktatur
- Texte zur Debatte um Raubgold und Entschädigung, Münster 1999. Konkret 1999-2000.