
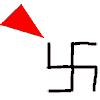
Der Deutsche Kolonialismus war nicht bloß eine kurze und vergleichsweise harmlose Episode, wie oft behauptet wird. Zum einen war er nicht nur auf die zu »Schutzgebieten« erklärten deutschen Kolonien beschränkt. Zum anderen war er eine wichtige Etappe bei der Herausbildung eines aggressiven Nationalismus, der in zwei Weltkriege und Vernichtungspolitik mündete.
von Reinhart Kößler und Henning Melber
Geschichtsvergessenheit untergräbt allzu oft selbst die besten Absichten. So geschehen, als Grünen-Politiker Christian Ströbele im Dezember 1999 in fraktionsoffizieller Funktion die Chancen Deutschlands bezüglich einer konstruktiven Rolle in Afrika damit begründete, »dass Deutschland das Glück hatte, sehr früh aus der Kolonialisierung gewaltsam herausgetrieben worden zu sein. (...) Dies ist eine Chance, (...) Deutschland kann eine Rolle übernehmen, die unbelastet ist und die deshalb eine Vorreiterrolle sein kann.«
Ströbele steht mit seiner Ignoranz deutscher kolonialer Geschichte
nicht allein. Als bei der Afrikareise von Bundeskanzler Schröder im Januar
2004 der Schwerpunkt auf Sicherheitspolitik lag, wurde das damit begründet,
man solle diese nicht den ehemaligen Kolonialmächten überlassen.
Just zum 100. Jahrestag des Beginns des Herero-Aufstandes in Deutsch-Südwestafrika
wurde so getan, als habe Deutschland nicht nur keine belastete oder eine weit
zurückliegende, sondern gar keine koloniale Vergangenheit. Der Schauplatz
des vom deutschen Staat verantworteten ersten Völkermords des 20. Jahrhunderts
wurde aus dem Besuchsprogramm des Kanzlers ausgespart. Vor Ort, im heutigen
Namibia, darf der deutsche Botschafter »bedauern«, aber nicht
sich offiziell entschuldigen. So blendet die deutsche Politik eine entscheidende
Dimension der deutschen Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
aus.
Doch anders als es sich die rot-grüne Koalition zurecht gelegt hat, waren
Kolonialideologie und koloniale Praxis keineswegs Randerscheinungen des Wilhelminischen
Zeitalters. Ebenso wenig lässt sich behaupten, die koloniale Vergangenheit
und Erfahrung habe einfach keine Rolle mehr gespielt, nachdem das Deutsche
Reich im Versailler Vertrag 1919 unter anderem auch seinen Anteil an der kolonialen
Herrschaftssphäre eingebüßt hatte.
Gewiss: Der Anteil des Deutschen Reiches an der kolonialen Beute, die während der letzten beiden Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts verteilt wurde, war nicht allzu ansehnlich. Versuche, sich in lukrativen Regionen wie Indochina oder in St. Lucia Bay an der südafrikanischen Küste in unmittelbarer Nähe der Goldvorkommen im Witwatersrand festzusetzen, scheiterten. Von den hochfliegenden Plänen eines »deutschen Indien« in Mittelafrika blieb gerade mal der Caprivi-Zipfel übrig, der dem heutigen Namibia seine bizarre geographische Form verlieh und eine Reihe von Problemen schuf. Die ruinöse Marokko-Politik führte zweimal an den Rand des Krieges mit Frankreich und brachte am Ende einige tausend Quadratkilometer ein, die der deutschen Kolonie Kamerun zugeschlagen und später in Versailles wieder in die französische Kongo-Kolonie eingegliedert wurden.
An Erwerbungen blieben somit vier Kolonien in Afrika: Mit Deutsch-Südwestafrika fing es 1884 (noch vor der Berliner Konferenz) an. Es folgten Togo, Kamerun und Deutsch-Ostafrika. Ferner konnte sich das Deutsche Reich dauerhaft in Ozeanien festsetzen: neben Samoa und einer Reihe von Inselgruppen wie den Karolinen und dem Marshall-Inseln gab es noch die Kolonie Kaiser-Wilhelmsland, heute das nordöstliche Drittel von Papua-Neuguinea. Schließlich sicherte sich das Reich noch einen Teil von der chinesischen Beute: das Pachtgebiet Kiautschau mit der umliegenden Provinz Shandong als Einflusssphäre.
All das wurde überhöht mit großspurigen Ansprüchen, wenn etwa der Kilimanjaro, dessen Kibo-Gipfel zur Kaiser-Wilhelm-Spitze erklärt wurde, der höchste Berg Deutschlands sein sollte. Am Ende erwiesen sich all die glorreichen »Schutzgebiete« jedoch als kostspielige Zuschussgeschäfte – mit Ausnahme Südwestafrikas, das durch den zufälligen Diamantenfund von 1908 recht unverhofft zu einem rentablen Geschäft wurde.
Auf den ersten Blick stimmt daher, was Ströbele Deutschland zugute hält: Nach gut drei Jahrzehnten war die Herrlichkeit schon wieder vorbei. Denn als man sich angeschickt hatte, den lauthals beanspruchten Platz an der Sonne ebenso wie zuvor die Einheit des Reiches mit »Blut und Eisen« endlich zu erringen, bewahrheitete sich, was weitsichtige Kritiker der Flottenpolitik schon lange gesagt hatten: In Wirklichkeit waren die Kolonien auch mit riesigen Anstrengungen militärisch nicht zu verteidigen und wurden nach wenigen Monaten von den Entente-Mächten besetzt, die sie später als Völkerbundsmandate ihren eigenen Kolonialreichen einverleibten.
Dies war jedoch noch längst nicht die ganze Geschichte der deutschen kolonialen Expansion. Weder beschränkte diese sich auf die Territorien, die von formaler kolonialer Besitzergreifung betroffen waren, noch ist sie mit der Vorstellung einer mehr oder weniger friedlichen Ausbeutung der kolonisierten Gesellschaften abgetan: die ideologische Ausstrahlung und das Idealbild der kolonialen Abenteuer dauerten fort, auch als letztere längst beendet waren.
Als zu spät gekommene Kolonialmacht realisierte das Wilhelminische Deutschland einen Großteil seiner Ambitionen nicht in staatsrechtlich sanktionierten kolonialen Erwerbungen, sondern in informellen Einflusssphären. Beispielhaft steht dafür der Bau der Bagdad-Bahn, der den deutschen Einfluss bis in den damals zum Osmanischen Reich gehörenden Irak ausdehnte. Deutsche Kriegsschiffe tauchten sogar vor der Küste Venezuelas auf, um der Eintreibung überfälliger Schulden Nachdruck zu verleihen.
Vor allem aber die Beteiligung an der China-Politik der übrigen Großmächte hatte Konsequenzen, die über die Kontrolle einer zweitrangigen Hafenstadt hinaus reichten. Als 1900 in China die Revolte der Ihetuan, im Westen als »Boxer« tituliert, nicht nur die Herrschaft der mandschurischen Qing-Dynastie erschütterte, sondern sich zugleich gegen die halbkoloniale Unterwerfung Chinas wandte, löste die Ermordung des deutschen Botschafters in Beijing eine internationale Intervention aus. Die Berliner Regierung sorgte nicht nur dafür, dass der deutsche General von Waldersee als »Weltmarschall« den Befehl über das internationale Expeditionskorps erhielt, das die Herrschaft der Qing und damit die Kontrolle der faktischen Kolonialmächte wiederherstellen sollte. In Gestalt seines Obersten Kriegsherrn erteilte das Deutsche Reich seinen soldatischen Abgesandten zudem den Auftrag, sich zu betragen wie einst die Hunnen in Mitteleuropa, damit auf Dauer dem deutschen Namen Respekt verschafft werde. Der nicht freundlich gemeinte, doch verdiente Spitzname »Huns« wurde von der Propaganda der Entente im Ersten Weltkrieg popularisiert und begegnet den Deutschen als Erinnerung an diese patriotische Sternstunde noch immer, etwa in britischen Zeitungskommentaren.
Einer, der sich die allerhöchsten Worte seinerzeit hinter die Ohren geschrieben hatte, war Lothar von Trotha, der unter dem Befehl des Weltmarschalls an der Gewaltorgie in Nordchina teilgenommen hatte und kurz darauf mit der Niederwerfung des Hehe-Aufstandes in Deutsch-Ostafrika betraut wurde. Als er 1904 den Oberbefehl zur Unterdrückung des Herero-Aufstandes in Namibia übernommen hatte, berief er sich auf seine Erfahrung beim »Rassenkampf«, in dem er »die aufständischen Stämme mit Strömen von Blut und Strömen von Geld« zu vernichten trachtete. Trothas berüchtigter Vernichtungsbefehl vom 2. Oktober 1904 war kein rhetorisch überzogener Ausrutscher, wie dies gelegentlich behauptet und geglaubt wird. Er wurde vom Chef des Generalstabs, General von Schlieffen, in seiner Intention ausdrücklich gut geheißen. Der Bericht des Generalstabs über den Herero-Krieg preist die Vernichtungsstrategie als »kühne Unternehmung«, die »die rücksichtslose Energie der deutschen Führung ... in glänzendem Lichte (zeigt).«
Trothas Proklamation an die aufständischen Nama verwies ein halbes Jahr nach dem Vernichtungsbefehl ausdrücklich drohend auf das Schicksal der Herero. Außerdem war die deutsche Völkermordstrategie nicht auf Südwestafrika beschränkt. Als Mitte 1905 der Maji-Maji-Aufstand die deutsche Kolonialherrschaft in Ostafrika erschütterte, reagierte die Kolonialarmee mit einer Politik der verbrannten Erde. Das gelang in einem erschreckenden Ausmaß: Von einigen der aufständischen Gruppen überlebten weniger als ein Achtel, die Zahl der Toten wird auf 200.000 bis 300.000 geschätzt. Dass diese Ereignisse der Amnesie im Hinblick auf deutsche Kolonialgeschichte noch stärker als der Krieg gegen die Herero und Nama zum Opfer gefallen sind, dürfte damit zu tun haben, dass im Maji-Maji-Krieg nur 15 Europäer umkamen, in Südwestafrika dagegen über 2.000 Schutztruppler.
Auch die Folgen der genozidalen Unterdrückungsstrategie waren unterschiedlich:
In Südwestafrika wurde das Land für weiße Siedler in der Perspektive
eines »Neudeutschland« freigeräumt, und das Unternehmen fand
immerhin eine Schranke, als man einsah, dass so auch dringend benötigte
Arbeitskräfte und heiß begehrte Viehherden vernichtet wurden. In
Ostafrika dagegen kam es zur weitgehenden Entvölkerung einer einst sehr
dicht besiedelten Region entlang eines der Haupthandelswege. So war am Ende
Platz geschaffen für das größte Wildreservat Afrikas, den
Selous Park.
Diese Politik blieb in Deutschland nicht unwidersprochen. Dafür kann
vor allem August Bebel stehen, der in einigen großen Reichtagsreden
nicht nur die koloniale Unterdrückungsstrategie verurteilte und die Verschleierungstaktik
des Reichskolonialamts entlarvte, sondern bereits 1905 vor allem den Zusammenhang
zwischen kolonialer Herrschaftspraxis und der Serie von Aufständen in
den deutschen Kolonien betonte: »(...) das Recht zur Revolution hat
jedes Volk und jede Völkerschaft, die sich in ihren Menschenrechten aufs
alleräußerste bedrückt fühlt. Wenn schließlich
nach allen diesen Taten (...) der Aufstand der Hereros ausbrach, und dann
eine Reihe der schlimmsten Greueltaten von seiten der Aufständigen begangen
wurde, so ist das nur die natürliche Folge unserer Kolonialpolitik, des
Verhaltens der Ansiedler, kurz der ganzen Tätigkeit, die von uns aus
in Südwestafrika ausgeübt worden ist.«
Der Blick auf die Kurzlebigkeit der formalen Kolonialgeschichte Deutschlands lenkt leicht von den eigentlichen Problemen und langfristigen Auswirkungen der Kolonialherrschaft ab. Diese bestehen gerade auch in der Rückwirkung von Kolonialismus und Imperialismus auf die metropolitane Gesellschaft. Der Zusammenhang zwischen der Realität der kolonialen Herrschaft einerseits sowie deutscher Innenpolitik und Alltagsbewusstsein andererseits ist gerade für die genozidalen Unterdrückungskampagnen seit 1904 mit Händen zu greifen.
Auch wenn er heute oft vergessen wird, spielte sich der Völkermord in Südwestafrika in hohem Maße im Licht der Öffentlichkeit ab. Soldaten konnten Ansichtspostkarten von Konzentrationslagern und Hinrichtungsszenen an ihre Lieben daheim schicken. Später kamen eine Vielzahl von Erinnerungsbüchern und populären Romanen hinzu, die teilweise häufige Neuauflagen erlebten. Am bekanntesten dürfte Peter Moors »Fahrt nach Südwest« von Gustav Frenssen sein. Das programmatisch betitelte Epos »Volk ohne Raum« von Hans Grimm, das 1926 erschien und dessen fiktiver Schauplatz Südwestafrika ist, wurde gar anlässlich der Weltausstellung in Chicago 1933 demonstrativ von den Nazis als einziges deutsches Buch und größtes literarisches Geisteserzeugnis des Volkes der Dichter und Denker zur Schau gestellt. Der Auflagenboom solcher Kolonialliteratur nahm erst 1945 ein abruptes Ende, wenn man von den Bemühungen kolonialapologetischer Initiativen in Deutschland oder der deutschsprachigen Minderheit in Namibia absieht, daran anzuknüpfen.
Die Kolonialpolitik stand in engem Zusammenhang mit dem wichtigsten außen- und militärpolitischen Projekt unter Wilhelm II, dem Schlachtflottenbau. Die daraus resultierende Politik hat nicht nur entscheidend zur Entstehung des Ersten Weltkriegs beigetragen, sondern basierte auch auf intensiver Mobilisierung großer Teile der deutschen Zivilgesellschaft in Flotten- und Kolonialvereinen. In ihnen stieß der radikale Nationalismus auf Resonanz und fand öffentliche Foren. Einen Höhepunkt erlebte diese Propaganda anlässlich der Reichstagswahlen 1907, die nicht zufällig als »Hottentottenwahlen« in die Geschichte eingingen. Reichskanzler von Bülow nutzte die von SPD und Zentrum vorgebrachte Kritik am Kolonialkrieg und der Kolonialverwaltung, um nicht nur den Reichstag aufzulösen, sondern auch eine grundlegende politische Umgruppierung einzuleiten. Aufgrund einer koordinierten Kampagne, die die patriotischen Vereine systematisch mit einbezog, gelang es den im »Bülow-Block« zusammengeschlossenen Parteien der Rechten, die langjährige Schlüsselstellung des Zentrums zu brechen und der SPD zum einzigen Mal vor dem Ersten Weltkrieg einschneidende Mandatsverluste beizubringen. Dies war ein wesentlicher Schritt in der Konsolidierung der Rechten, in der zunehmend modernistisch auftretende radikale Nationalisten den Ton angaben.
Nicht zu vernachlässigen sind auch die personellen Kontinuitäten zwischen kolonialer Verwaltung und Armee und der späteren Rechten in der Weimarer Republik sowie des Naziregimes. General Lettow-Vorbeck wurde aufgrund seiner Durchhaltestrategie, mit der er während des Ersten Weltkriegs in Ostafrika operierte, als Kriegsheld zum Idol der Rechten. Nach seiner Rückkehr wurde er mit frenetischem Jubel wie ein Sieger gefeiert. Mindestens so beispielhaft war die Karriere des Franz Ritter von Epp: 1900 Offizier im deutschen Korps bei der Niederschlagung des Ihetuan-Aufstandes, 1904-1907 als Offizier in Deutsch-Südwestafrika, General im Ersten Weltkrieg, 1919 Anführer des »Freikorps Epp« bei der Zerschlagung der Münchner Räterepublik, ab 1924 Präsident des Kolonialkriegerbundes, ab 1930 Reichstagsmandat der NSDAP, ab 1934 Leiter des Kolonialpolitischen Amts der NSDAP und 1940-41 schließlich Kolonialminister.
Die koloniale Herrschaftspraxis und Ideologie waren somit in vielerlei Hinsicht ein konstitutives Merkmal auf dem Weg zum NS. Hannah Arendts Erklärungsversuch der »Elemente totaler Herrschaft« in den 1950er Jahren führt nicht umsonst auf die historischen Wurzeln rassistischer deutscher Kolonialherrschaft zurück und lässt diese als integralen Aspekt der deutschen Gesellschafts-, Mentalitäts- und Kulturgeschichte erscheinen. Die Durchsetzung und Verteidigung deutscher Kolonialherrschaft in einer ganzen Serie von Kriegen in Ostafrika, Kamerun, Südwestafrika und Samoa verweist auf eine Kontinuität staatlich verantworteten Handelns zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die den Völkermord wenigstens als Möglichkeit systematisch mit einbezog. Das gilt sowohl für die militärisch verfolgte Strategie der Entscheidungsschlacht und der »Endlösung« als auch für die Vorstellung vom »Rassenkampf«, die zumindest im als Siedlungskolonie konzipierten Südwestafrika eine wichtige Rolle spielte.
Vor allem die Vernichtungsstrategie gegen die Herero wird heute von der Genozidforschung häufig als Fallbeispiel für Völkermord angeführt. Der erste deutsche Genozid tritt in der Diskussion jedoch nicht nur gegenüber dem zentralen Thema des Holocaust und jüngeren Massenverbrechen in Osttimor, Kambodscha, auf dem Balkan und in Rwanda deutlich zurück, sondern auch in der Genealogie des Völkermordes, etwa gegenüber dem türkischen Genozid an Armeniern. Eine systematischere Einordnung hätte sich vor allem an zwei historischen Achsen zu orientieren: Zum einen an den generellen Charakteristika kolonialer Herrschaft und Kriegsführung, zum andern an der spezifisch deutschen Entwicklung, die im Kontext des seit den 1890er Jahren einsetzenden »radikalen Nationalismus« wesentliche politische Voraussetzungen für den Nationalsozialismus schuf. Sie verweist zugleich auf eine Kontinuität in der Praxis des Völkermordes.
Dies gilt vor allem für die Konstruktion des Feindes: er wurde nicht nur als fremd und gegnerisch, sondern auch als nicht- oder untermenschlich erklärt. Dies ermöglichte weit eher die massenhafte, unterschiedslose Liquidierung solcherart umdefinierter Lebewesen, als wenn sie noch als Mitmenschen erkennbar gewesen wären. Die koloniale Situation leistete dieser Sichtweise Vorschub, weil hier die Markierung und Ausstoßung der »Fremden« weitaus leichter als unter den damaligen Bedingungen industriell-bürgerlicher Entwicklung in Deutschland gelang.
Zweifellos bestehen deutliche Unterschiede zwischen der gegen die aufständischen Herero angewandten Vernichtungsstrategie, sie in die wasserlose Steppe abzudrängen und dem Tod preiszugeben, und der industrialisierten Massenvernichtung, für die emblematisch Auschwitz steht. Gleiches gilt für die unterschiedliche Form der Konzentrationslager, in denen in Namibia Männer, Frauen und Kinder aus den aufständischen Gruppen gefangen gehalten wurden, und der Vernichtungslager des Dritten Reiches. In Südwestafrika wurden zwar ganze Gemeinschaftsverbände als Beteiligte am Aufstand unterschiedslos zu Gefangenen gemacht; die Sterbeziffern unter diesen rechtfertigen es, von Vernichtung durch Arbeit und Vernachlässigung zu sprechen. Das weit stärker systematisierte und nicht nur politische Gegner, sondern generell Angehörige bestimmter »Rassen«-Gruppen erfassende und vernichtende Netz der Konzentrationslager im Dritten Reich entspricht demgegenüber jedoch einer weiteren Entwicklungsstufe.
So wäre zwar der Versuch einer nahtlosen Fortschreibung des Völkermords im »Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika« zur organisierten Massenvernichtung unter dem Nazi-Regime zu vordergründig; doch dies schließt Verweise und Verbindungslinien nicht aus. Die Singularität des Holocaust ist in der Synthese und bürokratischen Systematik der verschiedenen Gewaltformen, ihrer rassistischen und antisemitischen Motivation und in dem so bewirkten unvorstellbaren Ausmaß der Gewalt zu suchen, keinesfalls hingegen in der vollständigen Zurückweisung einer Kontinuität zu den Vernichtungspraktiken des Kolonialismus.
Vielleicht bleibt deshalb die Auseinandersetzung mit diesen Verbindungslinien, ein Jahrhundert nach dem Vernichtungskrieg gegen die Herero und Nama, allenfalls zögerlich und fällt deutlich hinter die Auseinandersetzung mit dem NS zurück. Die anderen, in ihren Folgen ebenfalls verheerenden Kolonialkriege Deutschlands etwa in Ostafrika scheinen sogar vollends im Bewusstsein selbst der kritischen Öffentlichkeit verdrängt zu werden. Dabei sorgte der Deutsche Kolonialismus für den Bruch des letzten Tabus: die Vernichtung von als »anders« definierten Menschen in ihrer kollektiven Einheit nicht nur als Denkfigur zuzulassen, sondern auch in die Praxis umzusetzen.
Es verwundert nicht, dass die von Alexander und Margarete Mitscherlich diagnostizierte
»Unfähigkeit zu trauern« in den ersten Jahrzehnten nach dem
Zusammenbruch Nazi-Deutschlands Hand in Hand mit der fortgesetzten Blindheit
gegenüber den Vorstufen des Holocaust in der jüngeren deutschen
Geschichte ging. Es brauchte Mut, als Fritz Fischer vor über 40 Jahren
die von manchen bis heute angefeindete Auffassung begründete, dass es
in Deutschland seit Ende des 19. Jahrhunderts Anzeichen zu einer ausgeprägten
Kriegsbereitschaft gegeben habe und dass sich deutsche Verantwortlichkeit
auf beide Weltkriege erstrecke. Doch die kolonialen Wurzeln dafür wurden
auch von ihm nicht frei gelegt. Noch Mitte der 1950er Jahre konnte Lettow-Vorbeck
unwidersprochen seine Kolonialkriegs-Erinnerungen der Öffentlichkeit
präsentieren.
Während sich die (west)deutsche Öffentlichkeit ab Mitte der 1960er
Jahre eher gezwungenermaßen der Auseinandersetzung mit dem Holocaust
stellte, vermochte sie der Konfrontation mit dem kolonialen Erbe auszuweichen.
Die große Dekolonisierungswelle der 1950er und 1960er Jahre lenkte vom
deutschen Anteil an der Expansionsphase Europas eher ab, als dass sie den
Blick dafür geschärft hätte. Auch die Ende der 1960er Jahre
entstehende antiimperialistische Bewegung war zwar von der Identifikation
mit den »Verdammten dieser Erde« (Frantz Fanon) motiviert, konzentrierte
sich aber allzu leichtfertig auf die Unterstützung diverser Befreiungsbewegungen
und sozialer Emanzipationskämpfe in fernen Ländern. Dabei wurde
die eigene Sozialisationsgeschichte nur selten in einer Form aufgearbeitet,
die auch den deutschen Kolonialismus und seine Langzeitwirkungen – insbesondere
hinsichtlich binnengesellschaftlicher Effekte – selbstkritisch reflektiert
hätte. Dabei wurden auch innerhalb der internationalistischen Bewegung
Werte und Normen reproduziert, die nicht immer einer antirassistischen Perspektive
entsprachen.
1984 wurde mit der hundertjährigen Wiederkehr der Proklamierung Deutsch-Südwestafrikas und der Berliner Konferenz offenkundig, dass es bei der Auseinandersetzung mit dem Deutschen Kolonialismus erhebliche Defizite gab. Die breitere öffentliche Meinung sowie ein Großteil der einschlägigen Fachliteratur sah im (deutschen) Kolonialismus noch immer eine zwar mitunter ungerechte, aber letztlich notwendige Form des Fortschritts für die davon betroffenen Menschen. Die – zuvor und danach – vereinzelt betriebene »Bilderstürmerei« lokaler Initiativen, die mit Kampagnen zur Umbenennung von Straßen und Einrichtungen oder der Problematisierung kolonialapologetischer Denkmäler zur Sensibilisierung einer breiteren Öffentlichkeit beizutragen suchten, blieben Einzelaktionen mit bestenfalls begrenzter Wirkung.
So war es denn auch mehr die aufgrund innenpolitischer und binnengesellschaftlicher Entwicklungen virulenter werdende Debatte um Rassismus und multikulturelle Gesellschaft, die in den 1990er Jahren punktuell die bewusstseinsbildenden Traditionslinien zum Deutschen Kolonialismus thematisierte. Doch blieb auch dies letztlich eine Randerscheinung. Selbst die mittlerweile an einigen Universitäten hoffähigen »Postcolonial Studies« tragen bisher relativ wenig zur Erinnerung an die Phasen deutscher Herrschaft in anderen Teilen der Welt und deren Implikationen hierzulande bei. So bleibt mit einiger Skepsis abzuwarten, was sich im »Jubiläumsjahr 2004« an geläutertem Geschichtsbewusstsein artikuliert. Ob es über die wohlmeinende, offensiv vorgetragene Uninformiertheit des Christian Ströbele hinaus geht?
Reinhart Kößler ist apl. Professor für Soziologie an der Universität Münster, Henning Melber Forschungsdirektor am Nordic Africa Institute in Uppsala. Sie sind Gründungsmitglieder der Peripherie und Vorstandsmitglieder der Informationsstelle Südliches Afrika (ISSA). Der vorliegende Text basiert in Teilen auf einem umfangreichen Aufsatz für das Jahrbuch des Fritz-Bauer-Instituts.