
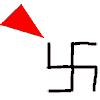
„Die Zukunft kommt von allein, der Fortschritt nicht.“ (Lukács)
Für den 14. Januar ruft ein breites Bündnis linker Gruppen und Initiativen in Frankfurt/Main zur einer Demo unter dem Motto „Alles muss man selber machen: sozialen Fortschritt erkämpfen“ auf. Vier Tage vor den hessischen Landtagswahlen wollen wir damit ein klares Signal setzen: Weder sind wir den gesellschaftlichen Entwicklungen ohnmächtig ausgeliefert, noch reicht es, alle Jubeljahre zur Wahl zu gehen in der Hoffnung, „die da oben“ mögen es schon richten. Ganz im Gegenteil musste bisher noch jeder soziale Fortschritt von einer außerparlamentarischen Linken erkämpft werden.
Politik, das ist der Prozess um die Ausgestaltung der Welt und des Lebens unter den bestehenden Bedingungen. Dieser Prozess ist in der kapitalistischen Gesellschaft keiner, in dem das sog. „Allgemeinwohl“ im Vordergrund stehen würde. Denn in einer in sich widersprüchlichen Gesellschaft gibt es kein „Allgemeinwohl“, vielmehr treffen unterschiedlichste, in Konkurrenz zueinander stehende Akteure aufeinander in der Absicht, ihre eigene (partikulare) Weltsicht als gesellschaftliches „Allgemeininteresse“ zu setzen und so zur Vorherrschaft zu bringen. Der Staat bietet dabei die Form, in der gemeinsame Politiken formuliert und innerhalb ihrer kapitalistischen Grenzen durchgesetzt werden können. Politik ist somit immer Kampf – ein Kampf, in den sich als emanzipatorisch verstehende Ansätze intervenieren müssen. Wohlgemerkt mit der Perspektive auf eine ganz andere Gesellschaft, die nicht mehr auf dem Kampf aller gegen alle, sondern auf einem gesellschaftlichen Miteinander beruht, in dem jedeR ohne Angst verschieden sein kann. Politik heißt also Handeln in dem bestehenden Rahmen – doch Kritik ist der Bruch mit diesen Verhältnissen, und das muss Ziel linksradikaler Interventionen sein. Politik macht dabei auch mit dieser Perspektive durchaus Sinn – doch nur, wenn dadurch sich Spielräume für Emanzipation und Kritik vergrößern. Nun findet dieser Kampf weder im luftleeren Raum, noch losgelöst von bestehenden Strukturen statt. Die gesellschaftliche Wirklichkeit beruht auf einer materiellen Basis, durchzogen von einer Vielzahl von Widersprüchen. Kritik muss deren genaue Analyse und Einbeziehung in die eigene Praxis leisten, will sie nicht in romantisches, weltfremdes Revoluzzertum verfallen.
War die Wirtschaft in der sozialstaatlichen Ära eine, die weitestgehend an den nationalen Rahmen gebunden war, so hat in den letzten Jahren eine zunehmende Internationalisierung eingesetzt. Nicht mehr Schutz und Abschottung der eigenen Wirtschaft vor internationaler Konkurrenz, sondern die Mobilmachung aller gesellschaftlichen Ressourcen zur Sicherung der globalen Wettbewerbsfähigkeit sind heute das Gebot der Stunde. „Standort, Standort über alles“ intonieren weltweit die gestriegelten Chorbuben und -mädchen der herrschenden Klassen – und die „Volksmassen“ stimmen begeistert ein, enthusiastisch die Fähnchen ihrer jeweiligen Nation schwingend. Jene, die nicht in den vorherrschenden Tenor einstimmen – sei es, weil sie nicht können oder gar, weil sie nicht wollen – bekommen indessen immer heftiger die autoritäre Seite des Bestehenden zu spüren. Wer die kapitalistische Totalität nicht akzeptiert und versucht, etwas dagegen zu tun, wird schnell ein Fall für Verfassungsschutz und staatliche Repression.
Wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll auch von der Krise schweigen
Entgegen aller Gerüchte zeigt die aktuelle Krise des Kapitalismus, die schwerste seit 1929, dass der Kapitalismus vor allen Dingen krisenhaft, dass er nicht steuerbar ist. Es herrscht Anarchie der Warenproduktion, gerade weil er nicht vernünftig organisiert werden kann; es zeigt sich, dass trotz aller Versuche einer sozialstaatlichen Transformation seine Basiskategorien nicht verändert werden können und so jene Mechanismen in ihm herrschen, die schon Marx vor 150 Jahren analysiert hat.
Die kapitalistischen Demokratien sind aktuell in eine schwere Legitimationskrise geraten, weil zu offensichtlich ist, welch traurige Figur sie im Angesicht der Krise machen. Es zeigt sich nur zu deutlich, dass im Kapitalismus die Dinge die Menschen regieren und nicht etwa die Menschen die Dinge. Es herrscht der Sachzwang – eben der Zwang des Kapitals.
Dabei lässt sich der Kapitalismus nicht, reichlich naiv, einteilen in böses Kapital (Finanzwirtschaft) und gutes Kapital (Realwirtschaft); vielmehr handelt es sich um zwei Ebenen im Kapitalismus, die sich gegenseitig brauchen und nicht alleine existieren können. Beide funktionieren nach den gleichen Mechanismen: möglichst viel Profit zu machen. Eine Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen ist eben gerade nicht das Ziel der kapitalistischen Produktion. Deshalb macht es auch keinen Unterschied für das Kapital, ob Essen, Medikamente oder Maschinengewehre verkauft werden – die Frage ist nur, ob es Profit bringt. Wer in dieser irrationalen Logik aller gegen alle verhaftet bleibt, weil er mit dem Kapitalismus nicht brechen will, kommt allzu schnell zu reaktionären Schlüssen, die gegen „Fremdarbeiter“, „faule Arbeitslose“ oder „raffgierige Manager“ hetzen.
Wenn die Politik von der schwersten Krise seit den 1920er Jahren redet, steht ein massiver Angriff auf soziale Rechte an, so verschieden diese auch sein mögen: Studiengebühren, Lohnverzicht, Rentenkürzungen, Arbeitslosengeldkürzungen, usw. …
Noch nie lagen die Möglichkeiten und Wirklichkeit im Kapitalismus so weit auseinander wie heute, wo ein Großteil der Proletarisierten weltweit im Elend vegetiert, während die produktiven Kapazitäten der Weltgesellschaft längst alle materielle Not überflüssig machen könnten. Nichts kann weiter weg sein von dem Marxschen Imperativ „jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen“. Die Antwort muss sein, die kapitalistische Produktionsweise samt ihren Folgen zu bekämpfen. Der Reformismus wird zu keiner vernünftigen Gesellschaft führen, denn sein Erfolg hängt vom Erfolg deren Gegnerin, der optimalen Verwertung des Kapitals, ab. Es gibt auch kein Zurück zum alten keynesianischen Wohlfahrtsstaat, denn mit dem Weltmarkt und der einhergehenden Standortkonkurrenz ist der Weg zu dahingehendem Reformismus verstellt. Ziel sollte eine Gesellschaft sein, in der die Menschen nicht mehr Objekt der ihr geschaffenen Verhältnisse, sondern Subjekt ihrer Geschichte werden. Wer dagegen (immer noch) Krankenschwester am Bett des Kapitalismus sein will (siehe z.B. Linkspartei), der versucht dieses brutale „Spiel“ Aller gegen Alle unnötig und aller Vernunft zum Spott zu verlängern.
14. Januar, 18 Uhr, Paulsplatz/ Ffm!
1. Aus Ermangelung einer Alternative zur Benennung der Utopie einer befreiten Gesellschaft benutzen wir den Begriff Kommunismus. Die notwendige Orientierung auf die Utopie als ein, in den kapitalistischen Verhältnissen, nicht positiv bestimmbarer und nicht realisierbarer gesellschaftlicher Zustand, drückt sich in der Forderung "Für den Kommunismus" aus. Eine Forderung, die die Abschaffung der Verhältnisse in denen "der Mensch ein geknechtetes, verächtliches und entfremdetes Wesen" (Karl M.) als minimalste inhaltliche Definition enthält. Dies umfasst eine Abgrenzung vom historischen, sowie aktuell noch bestehenden real existierenden Sozialismus (aka "Kommunismus"). Materialismus heißt in diesem Zusammenhang die Kritik und Negation der kapitalistischen Vergesellschaftung aus ihr selbst und ihren Widersprüchen heraus zu entwickeln. In diesem Sinne: Für den Kommunismus - Alles andere gab´s schon!
2. Natürlich können auch die Mitglieder der herrschenden Klassen nicht frei nach Gusto agieren, wie es momentan beispielsweise die Rede von den unmoralischen und raffgierigen Managern nahe legt. Ihr Handeln unterliegt Zwängen, die aus den vorgegebenen Bedingungen resultieren. Ihre Verhaltensweisen sind somit – wie die überhaupt aller Menschen unter kapitalistischen Bedingungen – formbestimmt.